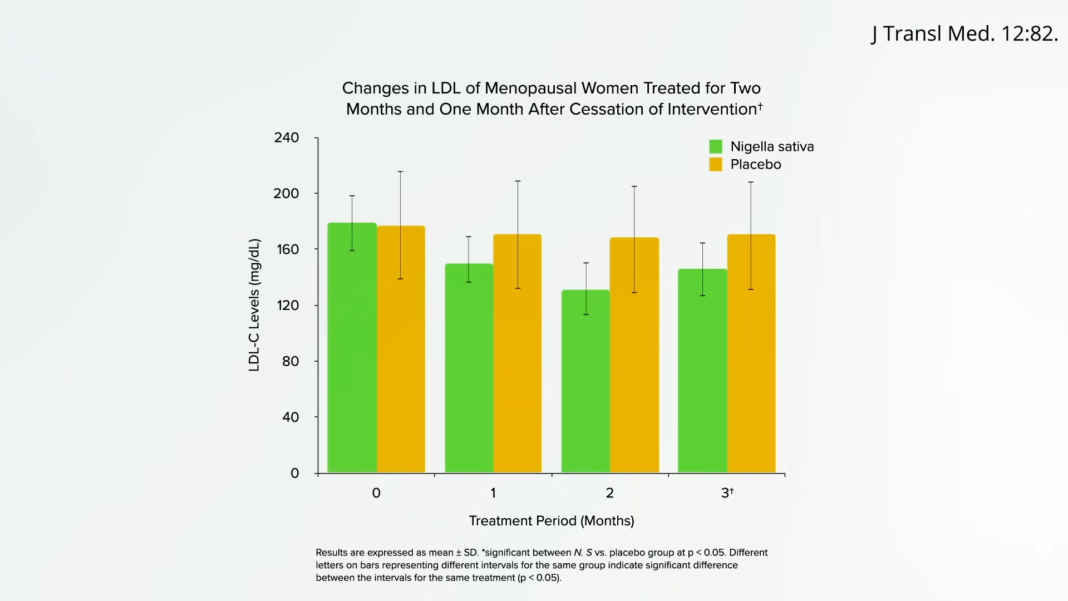Am 21. Juni 2025 hat die Aidshilfe Köln ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Auch Marcel Dams gratulierte – und brachte neben seiner eigenen Geschichte vier Dankeschöns und Wünsche für die Zukunft mit.
Wir dokumentieren Marcels Rede und danken herzlich für die Erlaubnis zur Veröffentlichung!
Ich bin ein Kind der Aidshilfe.
Vor 15 Jahren gab sie mir Halt.
Kurz nach meiner HIV-Diagnose hat sie mich begleitet, gestärkt, aber auch irritiert und herausgefordert.
Heute bin ich gewachsen, gehe eigene Wege, blicke mit mehr Abstand auf sie und komme doch immer wieder zurück, weil sie meine Heimat ist. Eine, mit der man sich verbunden fühlt, selbst wenn man sie mal verlässt.
Ohne sie wäre ich nicht, wer ich bin. Und es ist mir nicht egal, wie es mit ihr weitergeht.
Es ist der Blick der Aidshilfe auf die Gesellschaft und die einzelnen Menschen, der sie einzigartig macht.
Zum 40. Geburtstag habe ich deshalb vier Dankeschöns mitgebracht, verbunden mit Wünschen für die Gegenwart und Zukunft.
Persönlich, politisch, kritisch, vielleicht etwas unbequem. So wie Aidshilfe auch ist.
Ich habe mich entschieden, nicht nur die erwartbaren, offensichtlichen Dinge zu sagen, sondern um die Ecke zu denken.
Als Mensch mit HIV, als Sexualberater und als angehender Bildungswissenschaftler.
Denn eins ist klar: Die Arbeit der Aidshilfe war wichtig, ist wichtig und bleibt wichtig.
Es ist ihr Blick auf die Gesellschaft und die einzelnen Menschen, der sie einzigartig macht. Und genau diesen möchte ich herausarbeiten.
Dazu braucht es Zeit.
Die Aidshilfe hatte 40 Jahre.
Keine Sorge, die brauche ich nicht, aber lassen Sie sich 10 Minuten darauf ein.
Ich verspreche Ihnen, sie verstehen Aidshilfe und ihre Unverzichtbarkeit danach besser.
Erstens: Leistung lohnt sich nicht immer!
In unserer Gesellschaft zählt an vielen Stellen vor allem, wie „nützlich“ wir sind.
Migrant*innen und Geflüchtete gelten als umso willkommener, je mehr sie der Wirtschaft dienen.
Kranke sollen schnell genesen und ihre Arbeitskraft wieder zur Verfügung stellen.
Selbst der CSD in Köln und anderswo wird zunehmend über seine Wirtschaftsleistung legitimiert, als sei unser Kampf nur dann berechtigt, wenn er sich rechnet.
Wer nicht ständig an sich arbeitet, sich optimiert oder diszipliniert, gilt schnell als faul.
Auf Social Media wird vorgemacht, wie wir unsere Körper, unsere Beziehungen, unsere Noten, unser Einkommen verbessern können.
Maximale Ergebnisse in minimaler Zeit. Wer da nicht mitkommt, ist selber schuld. Denn jede*r kann es schaffen, man muss es nur wollen.
In Aidshilfe ist man willkommen, nicht, weil man etwas leistet, sondern als Mensch, egal in welchem Zustand.
Sogar „Self-Care“ wird ins System und den eng getakteten Terminkalender gepresst.
5-Minuten-Meditationen, kurze Atemübungen, ein schneller Kaffee, so hält man selbst produzierten Stress besser aus. Selbstfürsorge als eine von vielen Aufgaben.
Und das gilt auch für unsere Körper und Beziehungen.
Dating funktioniert wie ein Marktplatz: Wir präsentieren und betonen, was gut ankommt, verstecken, was den Marktwert mindert.
Bei sexuellen Funktionsstörungen (wie Lustlosigkeit oder Erektionsproblemen) geht es kaum noch um die Suche nach dem Sinn, sondern nur um die schnelle Behebung, damit der Körper wieder funktioniert. Denn nur störungsfreie Sexualität gilt als attraktiv.
Der harte Schwanz, lang durchhalten, Orgasmen hinterherrennen und die Anzahl der Partner*innen zählen mehr als folgende Fragen:
Bin ich sexuell zufrieden? Brauche ich all das dafür? Was erfüllt mich stattdessen?
Auch in Freundschaften, Familien oder Communitys soll man liefern, immer verfügbar sein, bloß keine Zumutung.
Und weil wir es ständig erleben, erscheint es uns normal. Das ist es nicht. Es ist gelernt. Eine gesellschaftlich eingeübte Haltung, die sich tief in unsere Beziehungen, unsere Körper und unser Selbstbild frisst.
Gesellschaftliche Kräfte wie Neoliberalismus, Rechtsruck oder soziale Medien wirken auf unsere innersten Beziehungen.
Der Aidshilfe möchte ich danken, weil sie für mich stets das Gegenteil war: Man ist willkommen, nicht, weil man etwas leistet, sondern als Mensch, egal in welchem Zustand.
Deshalb wünsche ich mir, dass noch klarer wird, was Verhältnisprävention[1] heißt: Nicht nur Zugang zu Gesundheit oder Abbau von Diskriminierung.
Sondern auch eine Kritik am System, das Menschen in allen Lebensbereichen unter permanenten Leistungsdruck setzt und soziale Arbeit unter ökonomischen Aspekten betrachtet.
Denn der Kampf um Anerkennung, um Ressourcen, um Sichtbarkeit, dieser Kampf findet nicht nur zwischen Konzernen statt.
Sondern auch in Familien, Partnerschaften, Freundschaften, sozialen Bewegungen, Communitys. Die Logik der Konkurrenz hat Orte erreicht, an denen es mal um Solidarität ging.
Die Qualität der Arbeit von Aidshilfe bemisst sich nicht an der Zahl der Klient*innen, der HIV-Tests oder der durch sexualpädagogische Angebote in Schulen erreichten Jugendlichen.
Sie bemisst sich daran, ob sich Menschen gesehen fühlen. Ob sie sich so sicher fühlen, dass sie sich zeigen können, auch mit ihren Brüchen und Zumutungen. Ob in ihnen etwas in Bewegung gerät, nicht auf Knopfdruck, sondern in einem Prozess, der Zeit braucht, Tiefe, Vertrauen.
Ob sie spüren: Ich bin hier willkommen. Ohne Vorleistung. Ohne Bedingung.
Liebenswürdig macht nicht die perfekte Karriere, der gestählte Körper oder die konfliktfreie Beziehung. Liebenswürdig machen das Unaufgeräumte, die Fehltritte, die Makel.
Die Qualität der Arbeit von Aidshilfe bemisst sich daran, ob sich Menschen gesehen fühlen.
Ich bitte also darum, dass Aidshilfe ihren starken politischen Einfluss in unserer Stadt und darüber hinaus nutzt – für eine Gesellschaft, die Menschen auch jenseits von Gesundheit nicht optimieren will, sondern nimmt, wie sie sind.
Eine Aidshilfe, die nicht nur Symptome, sondern gesellschaftliche Strukturen bekämpft, die viele von uns krank machen und zu Phänomenen wie Sucht oder psychischen Erkrankungen führen.
Eine Aidshilfe, die nicht, wie es an anderen Stellen oft geschieht, die Individuen für ihre Lage allein verantwortlich macht, sondern das System in Verantwortung nimmt.
Eine Aidshilfe, die daran erinnert: Nicht die Menschen sind falsch, das System ist es oft!
Zweitens: Die Mitte der Gesellschaft Mitte sein lassen!
Zuletzt hörte ich oft von Aidshilfe: „Scham und Schuld müssen endlich enden.“ Auch in aktuellen Spendenkampagnen liest man von dramatischen Geschichten mit Happy End.
Ich weiß, was damit gemeint ist, und bin dankbar, wenn Diskriminierung benannt und bekämpft wird.
Manchmal klingt es so, als müssten alle gerettet werden. Als sei das Leben erst lebenswert, wenn wir gesellschaftlich integriert und in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.
Doch es gibt Menschen, die stehen am Rand. Und manche werden dort bleiben.
Nicht, weil sie gescheitert sind, sondern weil sie nicht anders wollen, können oder schlicht nicht eingeladen sind, solange sie sich nicht anpassen.
Die Mitte der Gesellschaft ist kein sicherer Ort für alle. Für manche ist das Einzige, was sie schützt: sich von dieser Mitte fernzuhalten.
Denn Emanzipation heißt nicht: Akzeptanz durch Anpassung. Sie ist keine Vorher-Nachher-Erzählung mit Happy End im Sinne von: „Früher ausgeschlossen, heute aufgenommen.“
Emanzipation heißt: Befreiung von Zwängen, von Normen, vom Anpassungsdruck.
Deshalb wünsche ich mir von der Aidshilfe, dass sie mehr Geschichten erzählt, in denen es keine Heilung gibt. Aber dennoch Würde und Überleben.
Denn das, was oft als „krank“ oder „kaputt“ abgetan wird, ist häufig eine Überlebensleistung, und Überleben allein darf schon reichen.
Die Mitte der Gesellschaft ist kein sicherer Ort für alle. Für manche ist das Einzige, was sie schützt: sich von dieser Mitte fernzuhalten.
Leben heißt nicht immer, heil zu werden. Leben heißt auch: Räume schaffen und Menschen finden, in und bei denen man anders sein darf.
Sich retten, oft nur gerade so, aber aus eigener Kraft. Dazu braucht’s keine Ratschläge derer, die uns erst in diese Lage brachten.
Drittens: die Aidshilfe als Ort, der mehr aushält als Harmonie
Die Aidshilfe hat mich im besten Sinne verunsichert. Ich traf auf verschiedenste Sichtweisen, Beziehungsmodelle, Kulturen, Vorlieben, Haltungen und fragte mich: Was davon bin eigentlich ich?
Vielleicht kennen Sie das: Man sitzt im Restaurant, die Karte hat zu viele Gerichte und plötzlich sehnt man sich danach, in der Puszta-Hütte am Neumarkt zu sein. Da gibt’s nur Gulasch, man muss nichts entscheiden. Man isst, was auf den Tisch kommt, und es schmeckt auch noch.
In Bezug auf Lebenswege schmeckt nicht allen dasselbe. Entscheiden kann man sich aber nur, wenn man Auswahl hat und wenn man überhaupt weiß, dass es Alternativen gibt.
Die Aidshilfe hat mir diese Alternativen gezeigt. Und auch wenn das vielleicht komisch klingt: Das war nicht immer leicht.
Denn Vielfalt ist kein schöner Insta-Post. Echte Vielfalt ist nicht harmonisch.
Sie ist unbequem, stellt Normen infrage, bringt Gewissheiten ins Wanken und manchmal auch die eigene Identität. Aber genau das ermöglicht Entwicklung.
Ich erinnere mich noch gut an Gespräche, die mich tief irritiert haben. Oft war ich skeptisch, manchmal auch abwehrend gegenüber anderen Meinungen. Aber genau das war der Punkt.
Vielfalt ist kein schöner Insta-Post. Echte Vielfalt ist nicht harmonisch.
Selbstwerdung und Veränderung passiert nicht dort, wo wir immer einig sind. Sie passiert im Konflikt. In der Reibung. In der Begegnung mit anderen, Unvertrautem, dem Unverständlichen.
Aidshilfe ermöglicht Räume, in denen man sich nicht auf einen Nenner einigen muss, in denen Identität nicht vorausgesetzt wird, sondern wachsen kann, im Kontakt, in Auseinandersetzung.
Deshalb wünsche ich mir, dass das Café Bach stärker wiederbelebt wird.
Nicht nur für Kaffee und Kuchen, auch als Raum für Debatte, Widerspruch, Bildung, Begegnung. Oder einfach für Schrullen, schräge Vögel und einsame Seelen, die nicht wissen, wohin.
Identität entsteht nicht und entwickelt sich nicht im stillen Kämmerlein. Sie wächst im Kontakt mit anderen, gerade mit jenen, die man nicht versteht.
Muss man auch nicht. Aber man ist auf sie angewiesen. Denn das eigene Ich kann erst im Unterschied zu anderen sichtbar werden. Es gibt kein Ich ohne Abgrenzung und Unterschiede.
Dafür wünsche ich mir wieder mehr Raum und mehr Vertrauen darauf, dass Konflikte Zeichen von lebendiger Vielfalt sind.
Denn Unterschiede sichtbar machen und aushalten, das war immer die Stärke der Aidshilfe.
Viertens: Den Menschen vertrauen und ihnen etwas zutrauen
Ich erinnere mich an die Corona-Pandemie: Überall herrschte der moralische Zeigefinger.
Stay the fuck home, Abstand, Verzicht!
Als wäre das alles ganz einfach, wenn man sich nur genug zusammenreißt. Als ginge es nicht um Nähe, Körperlichkeit, menschliche Grundbedürfnisse, die man nicht ohne Schaden dauerhaft pausieren kann.
Besonders eingebrannt hat sich bei mir ein Interview mit einer jungen Frau aus Berlin im ZDF.
Sie sagte, dass es ihr schwerfalle und sie traurig mache, auf so viel verzichten zu müssen.
Was folgte, war ein Shitstorm. Dabei hatte sie nicht gegen Regeln verstoßen oder war Risiken eingegangen, sie hatte Bedürfnisse geäußert.
Empörung löst das nur aus, wenn man eigene Bedürfnisse (aus Selbstschutz?) so unterdrückt, dass man sie auch anderen nicht gönnt.
Die Aidshilfe veröffentlichte damals einen Flyer, wie man Risiken reduziert, auch wenn man weiterhin Sex hat. Mein erster Gedanke war: Das ist mal konsequent.
Denn genau das hat sie schon bei HIV getan und tut es bis heute: Keine Verbote. Keine Abwertung von Bedürfnissen oder Lust. Sondern informieren, ermöglichen, Menschen ernst nehmen.
Die Aidshilfe hält Menschen für fähig, mit Unsicherheiten umzugehen, und weiß: Wer aufklärt statt moralisiert, stärkt Selbstbestimmung.
Dieses Menschenbild – Vertrauen statt Kontrolle – kenne ich von kaum einer anderen Organisation.
Aidshilfe fragt nicht nur, wie man Infektionen verhindert, sondern auch, ob Menschen zufrieden sind. Und sie weiß: Wer das wirklich sein will, muss manchmal Risiken eingehen.
Doch derzeit beobachte ich, als Sexualpädagoge und Bildungswissenschaftler, eine Tendenz im gesellschaftlichen Diskurs: Sexualität soll rein, eindeutig, absolut sicher sein. Das sind Nachwirkungen von Corona.
Als wäre Lust nur legitim, wenn sie klinisch sauber und frei von Widersprüchen ist. Doch Sexualität und Leben sind nie frei von Risiko und Ambivalenz.
In Zeiten von Gesundheit als höchstem Ideal, wo Risikofreiheit wichtiger scheint als Lebensqualität, setzt die Aidshilfe einen Kontrapunkt.
Sie fragt nicht nur, wie man Infektionen verhindert, sondern auch, ob Menschen zufrieden sind. Und sie weiß: Wer das wirklich sein will, muss manchmal Risiken eingehen.
An dieser Stelle wünsche ich der Aidshilfe keine Veränderung, nur, dass sie sich treu bleibt.
Dass sie sich weiter aus ihrer Geschichte heraus versteht: als Bewegung für Lust, Genuss, Selbstbestimmung und dafür, Ambivalenzen auszuhalten und anzuerkennen.
Widersprüche nicht nur zu ertragen, so, als ob man ihnen wie ein Opfer ausgeliefert wäre, sondern sie als notwendigen Teil von Lebendigkeit, vom Leben zu begreifen.
Vielleicht fühlen sich in Aidshilfe deshalb so viele Menschen wohl, die sich sonst nirgends zugehörig fühlen, weil ihnen hier zugetraut wird, die passenden Entscheidungen für sich selbst zu treffen.
Die Aidshilfe tut das seit 40 Jahren. Und ich habe keinen Zweifel, dass sie damit weitermacht.
Gerade in gesellschaftlich schwierigen Zeiten macht das Hoffnung, weil es ein kleines, aber wichtiges Puzzlestück für unsere Demokratie ist, die auf Kommunikation, Mündigkeit und einem akzeptierenden Blick auf reale Lebensweisen beruht.
Ich möchte mit für mich wichtigen Worten enden.
Für mich ist die Aidshilfe Familie. Und ich bin sehr glücklich, dass so viele Menschen sie mitgestalten und Teil meines Lebens geworden sind.
Die Aidshilfe wird gebraucht, weil sie an der Seite der Menschen steht. Oft über den Tod hinaus.
Es ist schmerzhaft, wie viele Freund*innen wir verloren haben. Aber immer, wenn ich im Café Bach an der Gedenkwand stehe, weiß ich: Selbst der größte Schmerz wird erträglicher, steht man zusammen, ist man nicht allein.
Und ich fühle mich seit 15 Jahren weniger allein. Nicht nur in Bezug auf HIV. Dafür bin ich gerade in den aktuellen Zeiten zutiefst dankbar.
Natürlich werden wir weiter zusammenstehen und füreinander einstehen. Dafür ist und bleibt die Aidshilfe der richtige Ort.
Ich freue mich, auch in Zukunft mit dabei zu sein.
Vielen Dank!
[1] Anm. d. Red.: Verhältnisprävention ist ein Begriff aus dem Konzept der Strukturellen Prävention, das der Aidshilfe-Arbeit zugrundeliegt: Es nimmt das Verhalten Einzelner ebenso in den Blick wie die Verhältnisse (Strukturen), in denen sie leben. Denn was die Einzelnen zu ihrer Gesundheit und zur Verminderung von Risiken beitragen können, hängt stark von ihrem sozialen Umfeld, Gesellschaft und Politik ab.
Beiträge zu Aidshilfe-Arbeit und Struktureller Prävention (Auswahl)
Interview mit Dirk Meyer, der fast 40 Jahren in Aidshilfe-Strukturen gearbeitet und sie geprägt hat (2025)
Würdigungen zum 80. Geburtstag von Rainer Schilling, der die Deutsche Aidshilfe mit aufbaute und ihre Prävention maßgeblich prägte (2023)
Beitrag von Marco Kammholz zu Struktureller Prävention und Aidshilfe-Arbeit in der Covid-19-Pandemie (2021)
Beitrag von Michael Jähme zum Verhältnis von Positivenselbsthilfe und Aidshilfe (2017)